|
Nervensystem: Übersicht
Das Nervensystem erfasst, leitet, verarbeitet, speichert Informationen und sendet selber Informationen aus. Zusammen mit dem Hormonsystem steuert das Nervensystem lebenswichtige Organe und passt deren Leistungen den Anforderungen der Außenwelt an. Das Nervensystem wird unterschieden in zentrales und peripheres Nervensystem. Zum Zentralnervensystem (ZNS) gehören Gehirn und Rückenmark, zum peripheren Nervensystem alle Nervenzellen und Nervenbahnen außerhalb des ZNS. Eine weitere Unterscheidung des Nervensystems findet nach der Funktion statt. Das vegetative oder autonome Nervensystem steuert lebenswichtige Organe und Funktionen (Vitalfunktionen). Die Organe arbeiten „autonom“, das heißt, sie sind der willkürlichen Kontrolle entzogen. Das somatische oder animalische Nervensystem dagegen kann willkürlich oder bewusst reagieren. Manche Organe werden von beiden Systemen gesteuert, wie beispielsweise die Lunge. Die Atmung erfolgt automatisch, kann aber willentlich beeinflusst werden. Das vegetative Nervensystem wird in drei Systeme untergliedert:
Sympathikus und Parasympathikus sind funktionell Gegenspieler (Antagonisten) und wirken ergänzend, um den menschlichen Körper optimal an ständig wechselnde Bedingungen anzupassen. Die Nervenzellen des Sympathikus entspringen im Brust- und Lendenrückenmark, durchziehen den gesamten Körper und erhöhen die nach außen gerichtete Aktionsfähigkeit bei tatsächlicher oder gefühlter Belastung. In einer Stresssituation setzt der Sympathikus den Neurotransmitter Noradrenalin (Biochemischer Botenstoff und Hormon) frei und schickt ihn zu Zielorganen. Dadurch steigt beispielsweise die Herzfrequenz, Herzkranzgefäße weiten sich, Blutgefäße verengen sich, Blutdruck steigt, die Bronchien erweitern sich, die Verdauung wird gehemmt, Harnausscheidung vermindert und die Pupillen vergrößert. Der Mensch ist in einem Zustand hoher Aufmerksamkeit (Flucht). Die Nervenzellen des Parasympathikus entspringen im Gehirn und Kreuzbeinrückenmark, sind ebenfalls im ganzen Körper verteilt und versetzen den Körper in den „Ruhezustand“. Der Parasympathikus setzt den Neurotransmitter Acetylcholin (Biochemischer Botenstoff) frei, wodurch Herzfrequenz und Blutdruck sinken, Herzkranzgefäße, Bronchien und Pupillen sich verengen, Blutgefäße sich erweitern und die Verdauung und Harnausscheidung gefördert wird. Der Körper kann sich regenerieren, körpereigene Reserven aufbauen und den Stoffwechsel verstärken. Das enterische Nervensystem nimmt eine Sonderrolle im vegetativen Nervensystem ein. Es steuert den Magen-Darm-Trakt und stellt ein selbstständiges Regelsystem dar.
Das Nervensystem besteht aus Nervengewebe, ein stark differenziertes Gewebe mit der Fähigkeit zur Erregungsbildung, Erregungsleitung und Erregungsverarbeitung. Das Nervengewebe ist neben Muskel-, Epithel- und Bindegewebe eine der vier Grundgewebearten. Es besteht aus Nervenzellen (Neuronen) und Gliazellen (Hüll- und Stützzellen). Im Gegensatz zu den Nervenzellen können sich Gliazellen lebenslang teilen und damit erneuern.
Eine Nervenzelle ist eine spezialisierte Zelle, deren Aufgabe die Erregungsleitung und Erregungsübertragung ist. Eine Nervenzelle mit allen Fortsätzen wird auch als Neuron bezeichnet. Die Verknüpfung der Nervenzellen untereinander und mit den Organen geschieht über die Synapsen. Die Nervenzelle besteht aus dem Zellkörper mit dem Zellkern und Zytoplasma. Die Dendriten sind verzweigte Ausstülpungen des Zytoplasmas. Sie nehmen Impulse auf und leiten sie weiter zum Zellkörper (Signalaufnahme). Der Nervenzellfortsatz oder Axon ist ebenfalls ein Zytoplasmafortsatz, der sich zum Ende hin auch stark verzweigt. Er überträgt die Impulse aus dem Zellkörper zu anderen Neuronen oder Muskel-, Drüsenzellen. Die Axone haben unterschiedliche Längen (von Millimetergröße bis zu einem Meter) und sind meist von einer Markscheide umgeben. In der Regel besitzt eine Nervenzelle zahlreiche Dendriten, aber nur ein Axon. Bei den peripheren Nerven (Nerven außerhalb des Gehirns und Rückenmarks) werden die Axone schlauchartig von speziellen Gliazellen (Schwann-Zellen) umhüllt. Diese schützende Ummantelung nennt man Markscheide. Die Markscheide dient der Ernährung und dem Schutz der Nervenfaser und beschleunigt die Erregungsleitung. Zwischen zwei Schwann’schen Zellen, die den Axon umwickeln, befinden sich die sogenannten Ranvier-Schnürringe. Dort liegt das Axon frei. Ein Axon mit seiner Umhüllung wird Nervenfaser genannt. Es gibt auch Bündel von mehreren parallel verlaufenden Nervenfasern mit einer gemeinsamen Bindegewebshülle, die zusammen einen Nerv bilden. Gliazellen sind nicht nur reine Hüll- und Stützzellen, die unterschiedlichen Gliazellen versorgen auch die Nervenzellen mit Nährstoffen, sind am Aufbau der Markscheiden beteiligt, wehren Krankheitserreger ab, entsorgen abgestorbene Zellen und haben eine Filterfunktion. So sind sie an der Blut-Hirn-Schranke beteiligt, die die empfindlichen Nervenzellen vor schädlichen Stoffen schützt.
Siehe: Krankheitsbilder Multiple Sklerose
Lernzielkontrolle: Nervenzelle
Gehirn (Encephalon [gr.], Cerebrum [lat.], Brain [engl.])
Hirnhäute (Meningen)
Hirnhäute setzen sich außerhalb des Schädels fort als Rückenmarkshäute (Dura mater spinalis: zur Wirbelsäule, zum Rückenmark gehörig) Klinisch: Meningitis (Hirnhautentzündung); Symptome sind Kopfschmerzen, Fieber, Nackensteifigkeit; Ursache ist eine Infektion mit Viren, Bakterien, Pilze, selten Krebs- oder Autoimmunerkrankung
Großhirn
Klinisch: Apoplex, Blutung, Demenz, Multiple Sklerose, Hirntumore
Kleinhirn
Klinisch: Gangstörungen (ataktische Gangunsicherheit, Rumpfataxie), Sprechstörungen (langsam, abgehackt, verwaschen), Koordinationsstörungen, Störung der Feinmotorik, herabgesetzter Muskeltonus, Intentionstremor (Zittern der Gliedmaßen bei zielgerichteter Bewegung); mögliche Ursachen sind langjähriger Alkoholabusus, Medikamente (Z.B. Antiepileptika), Großhirnläsionen (Verletzung, Erkrankung des Großhirns), Multiple Sklerose, Apoplex, Tumore, Degeneration (durch Verschleiß bedingt)
Zwischenhirn 3D-Anmation
Der Hirnstamm ist stammesgeschichtlich der älteste Teil des Gehirns und besteht aus Mittelhirn, Nachhirn und Brücke.
Mittelhirn
Klinisch: Z. B. degenerative Systemerkrankungen des ZNS, zerebrovaskuläre Insuffizienz, Vergiftungen (Z. B. Kohlenmonoxid), Fehlen von Neurotransmittern, Parkinson-Syndrom
Nachhirn
Brücke
Balken
Der Balken mit ungefähr 200 Millionen Fasern verbindet die beiden Hirnhälften und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen den beiden Hirnhälften. Die Großhirnhemisphären haben teils unterschiedliche Aufgaben, die ergänzt werden müssen. Die Informationen der gegenüberliegenden Körperseite muss verarbeitet und mit der anderen Körperseite koordiniert werden. Der Austausch vermeidet Überlagerungen.
Hirnnerven
Als Hirnnerven bezeichnet man Nerven, die direkt aus spezialisierten Nervenzellansammlungen (Hirnnervenkernen) im Gehirn entspringen und eine Durchtrittstelle innerhalb der knöchernen Struktur des Schädels haben.
Lernzielkontrolle Gehirn Kostenlose Homepage von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |
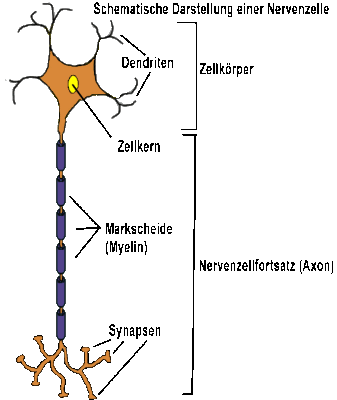
 Steuerzentrale des Körpers
Steuerzentrale des Körpers